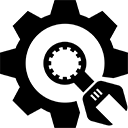
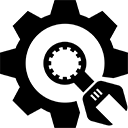
Liebe Leserinnen und Leser,
leider kann unser Angebot aufgrund des Wegfalls von Förderungen nicht mehr aufrechterhalten werden. Unsere Website wird daher ab Januar 2024 nicht mehr bearbeitet. Auch unsere digitalen Beratungsangebote sowie die beliebten Senior*innen-Workshops können wir nicht mehr anbieten. Das bedauern wir sehr. Die Seniorenagentur Frankfurt der GFFB gGmbH bedankt sich für Ihr Interesse an unserem Projekt und wünscht Ihnen alles Gute!
Mehr Informationen zu den Kürzungen, die dieses Angebot beendet haben, finden Sie unter https://www.gffb.de/jahresende-2023/